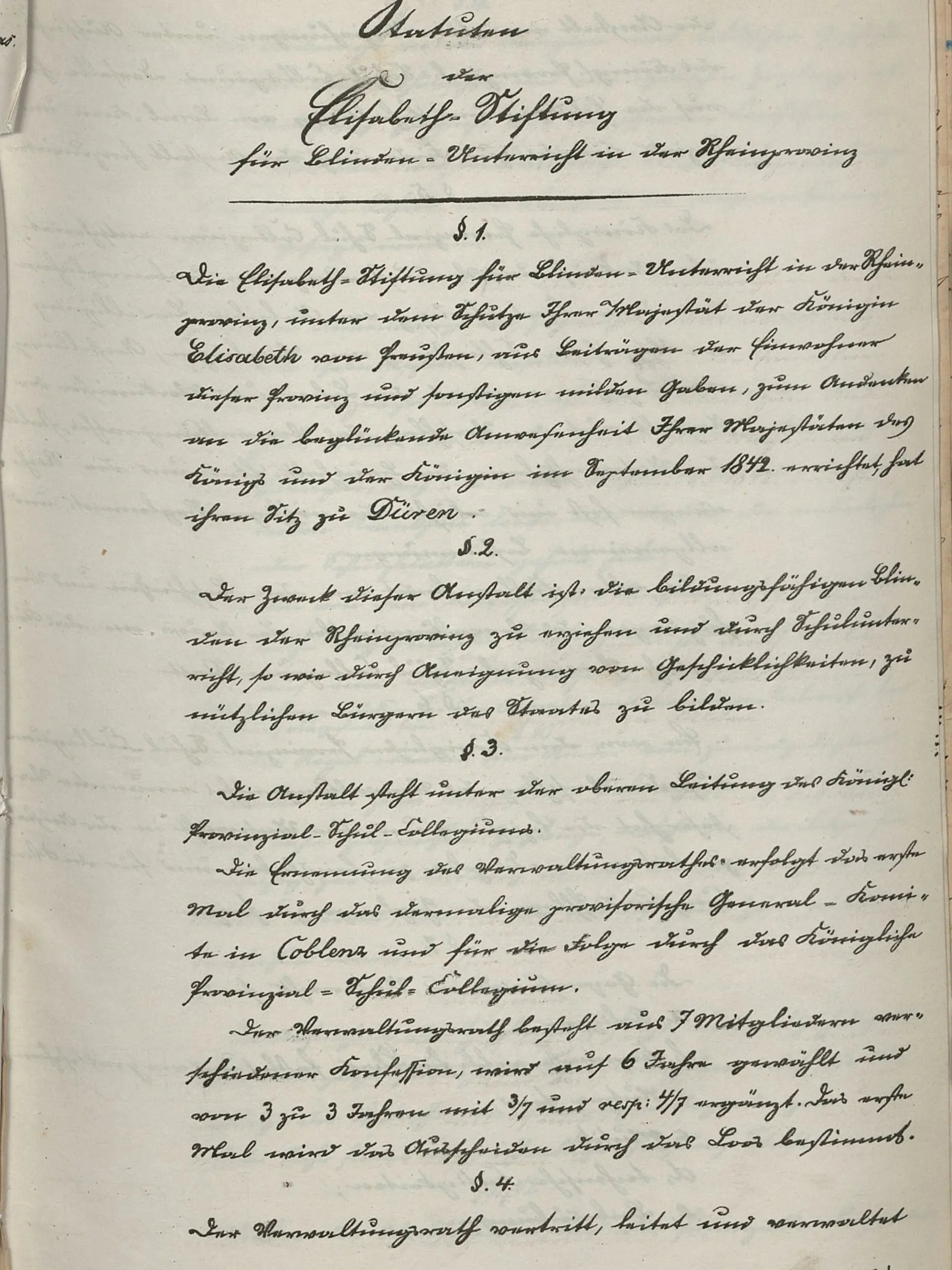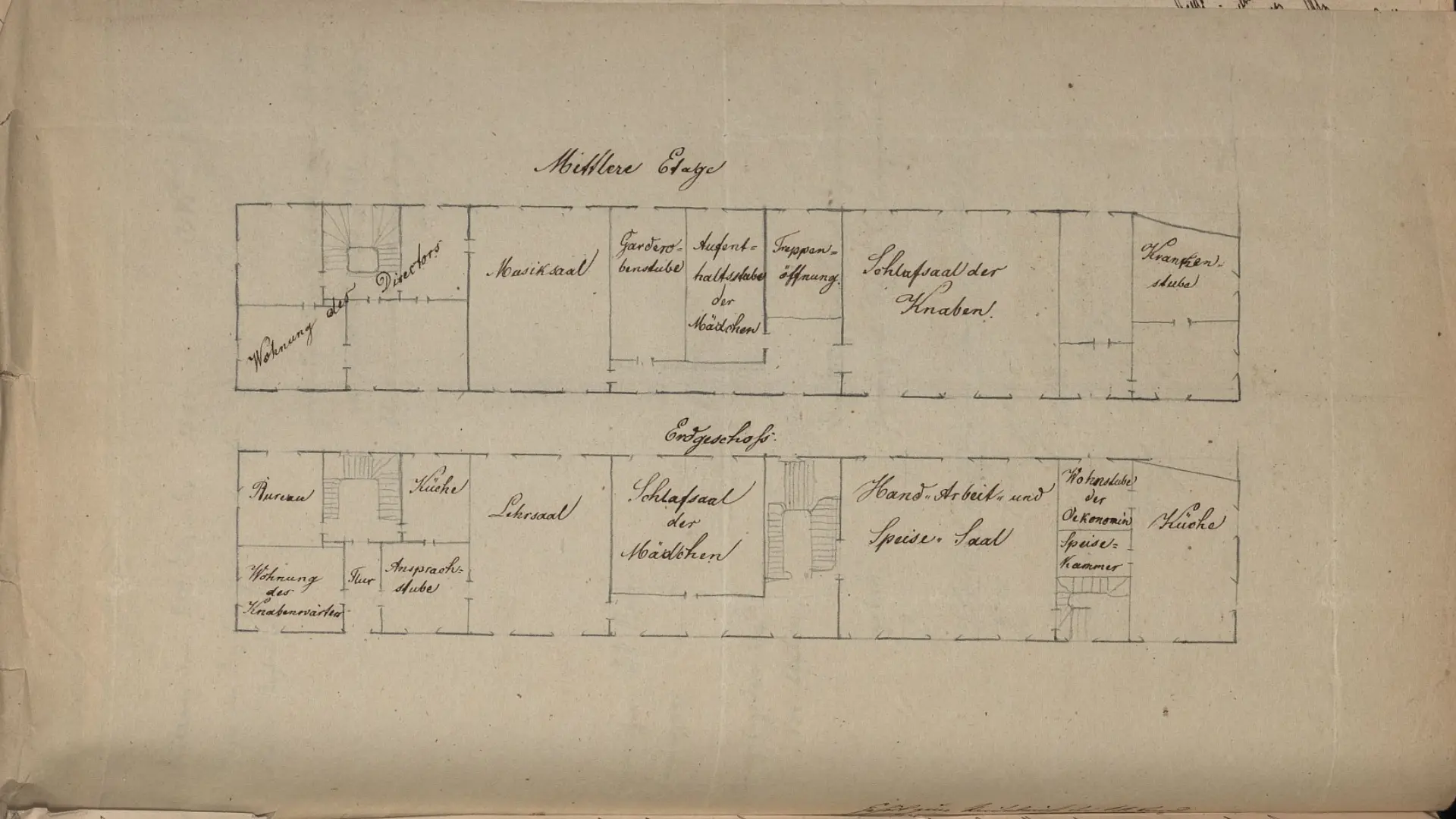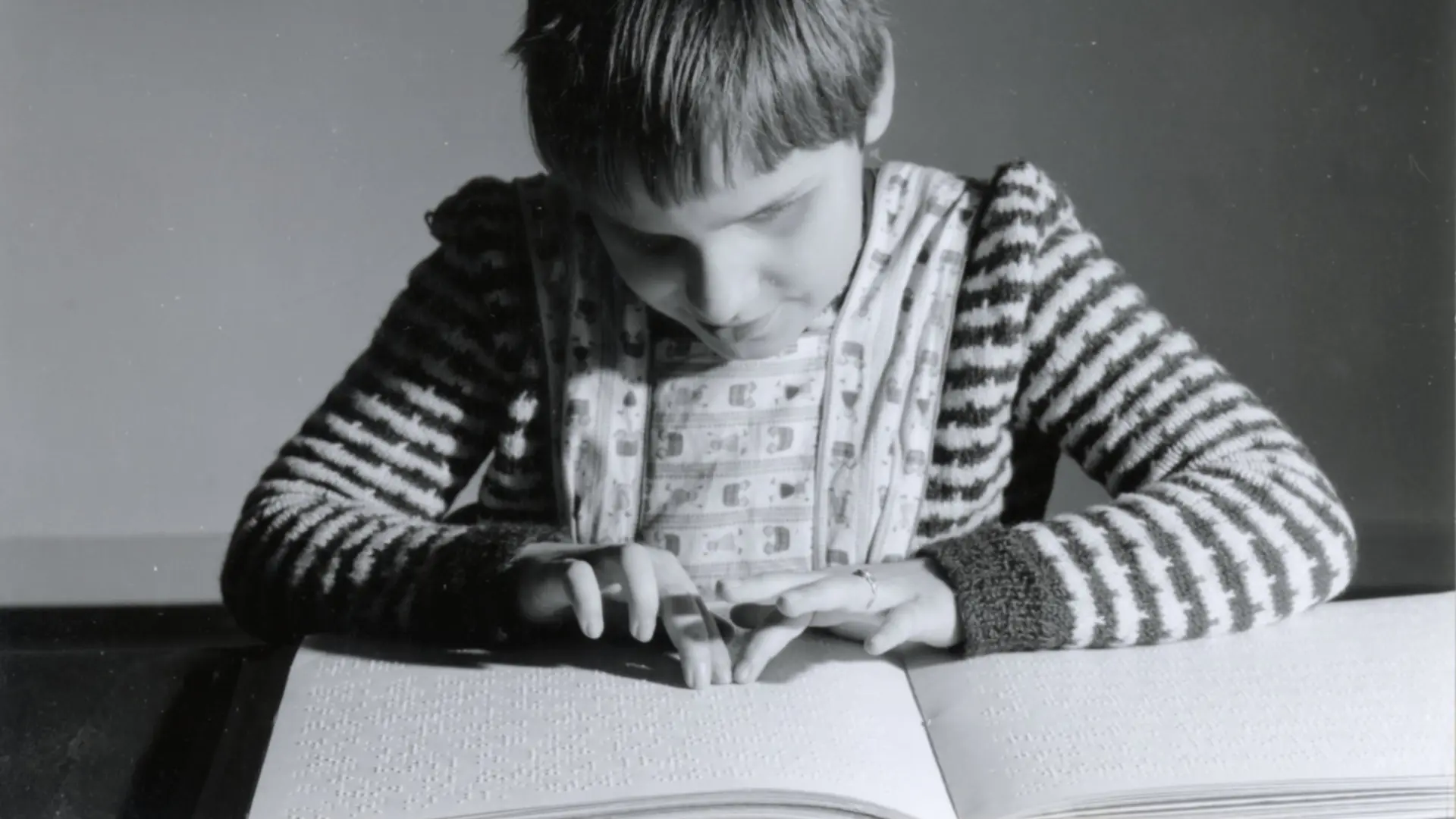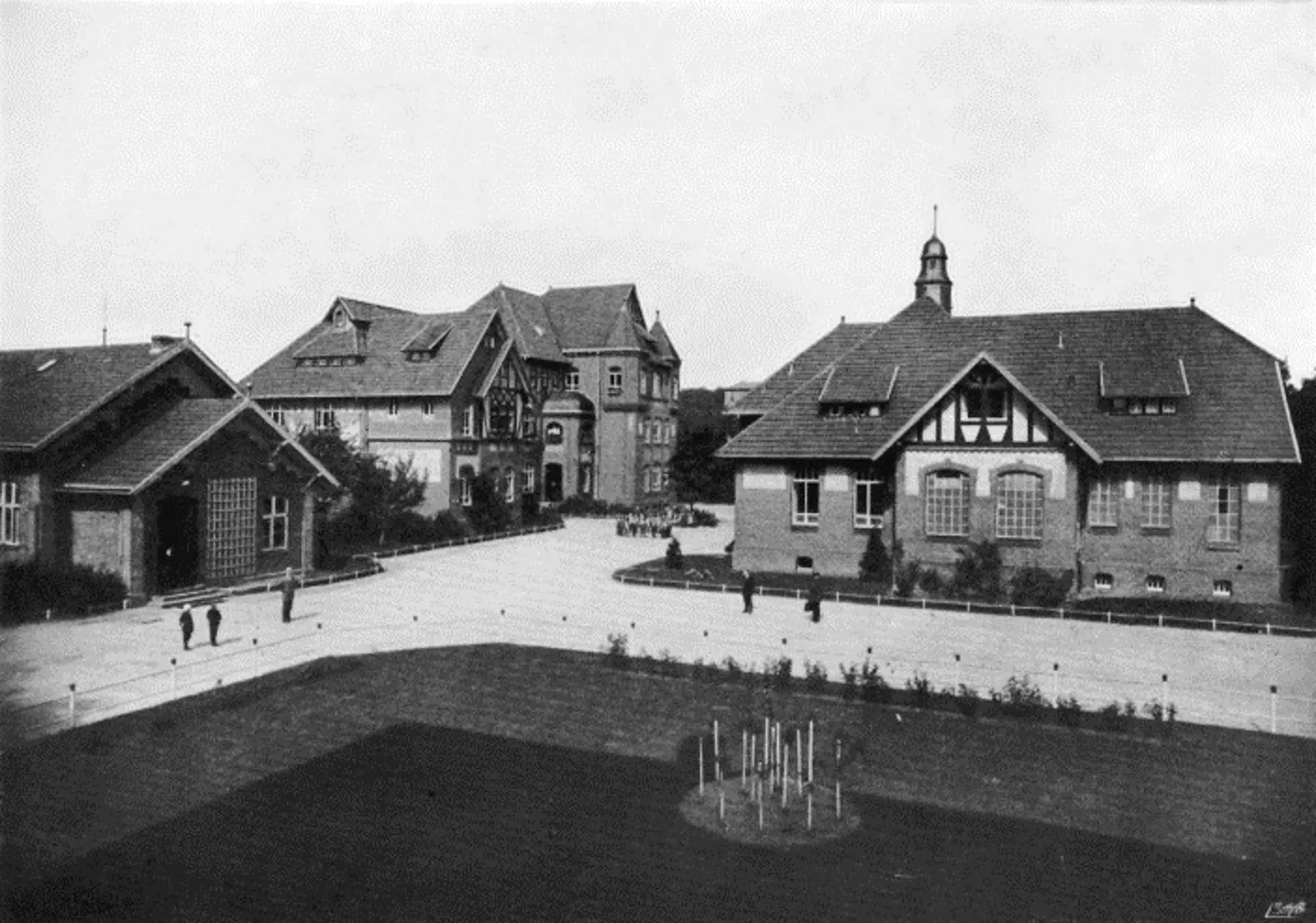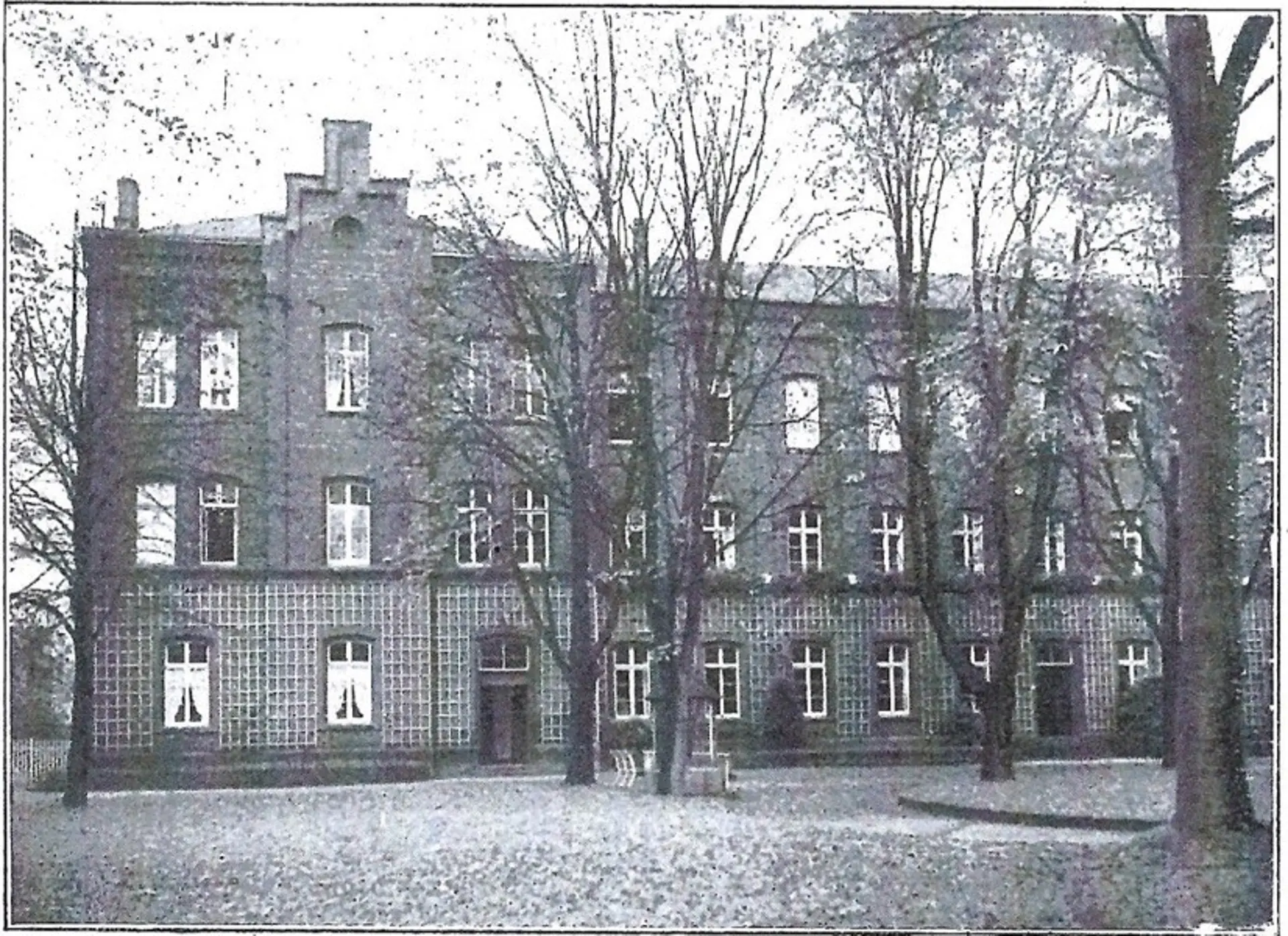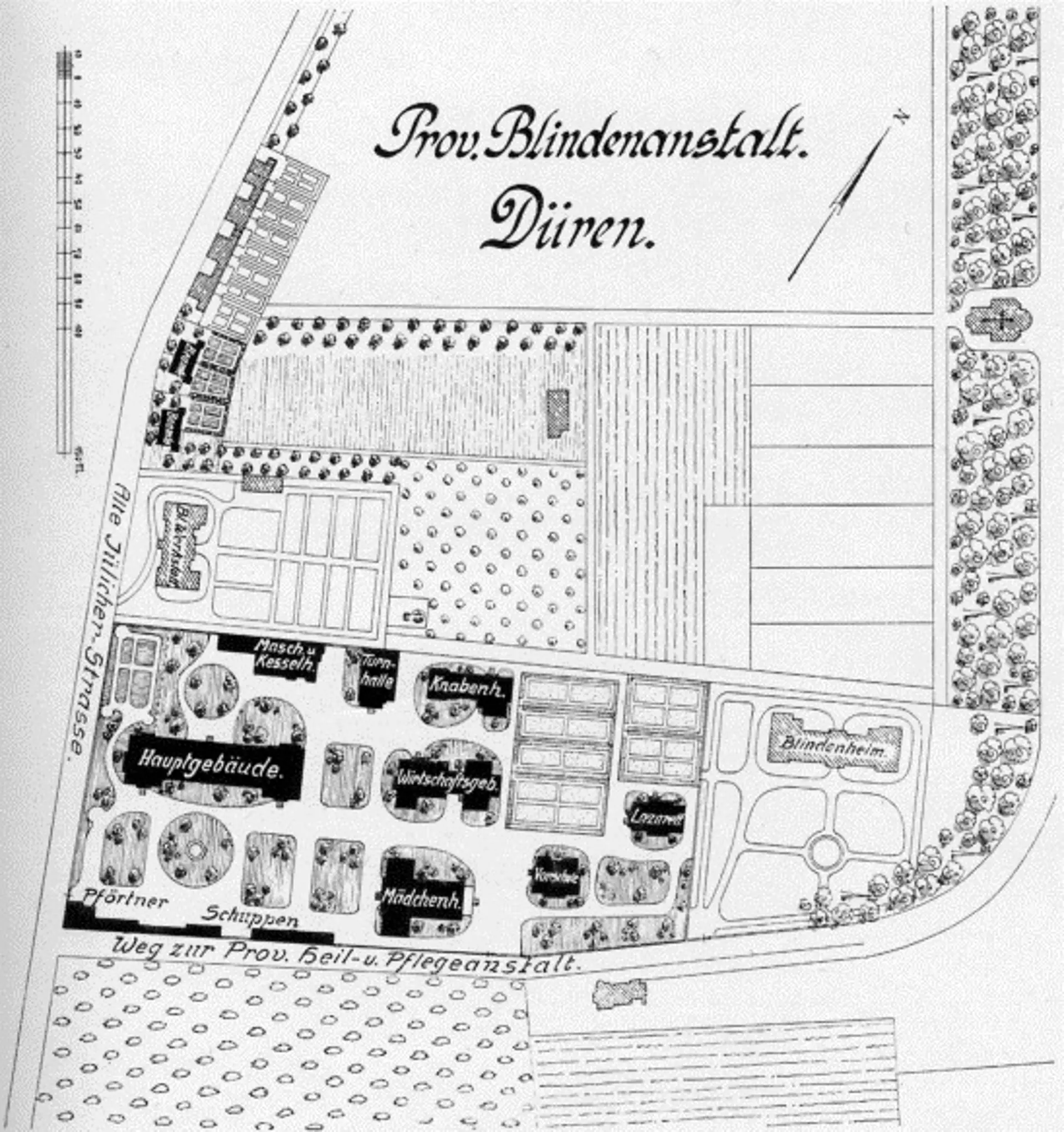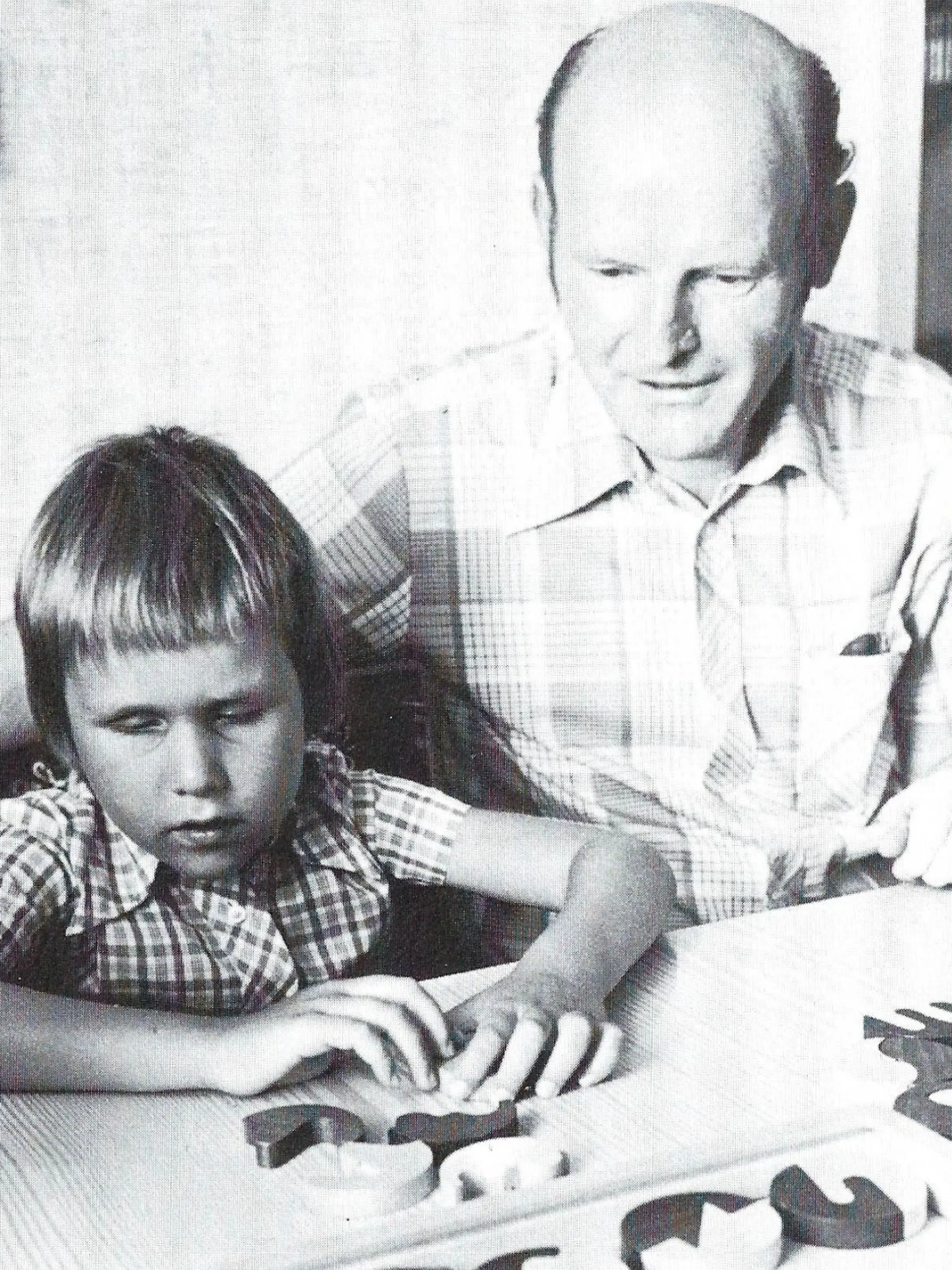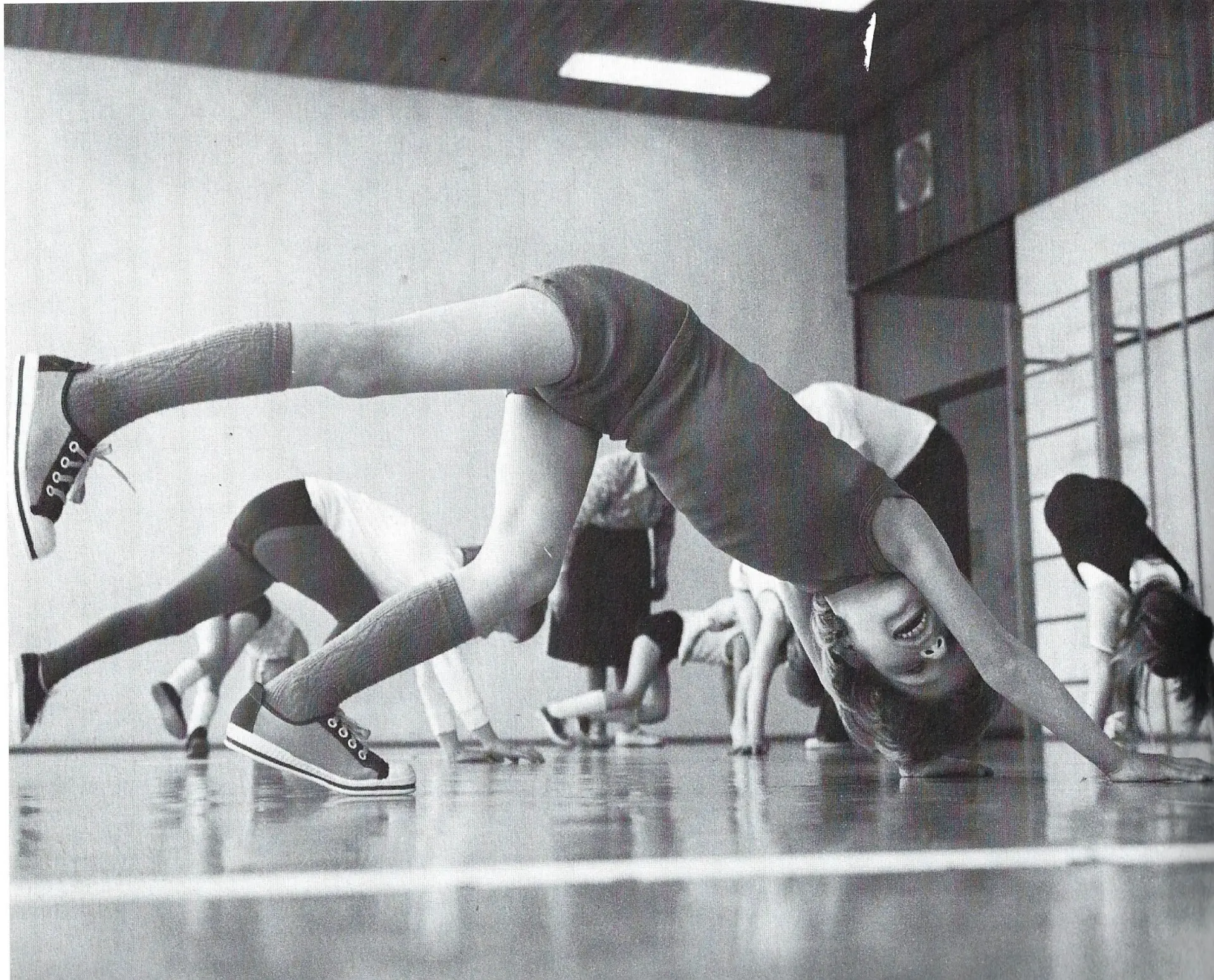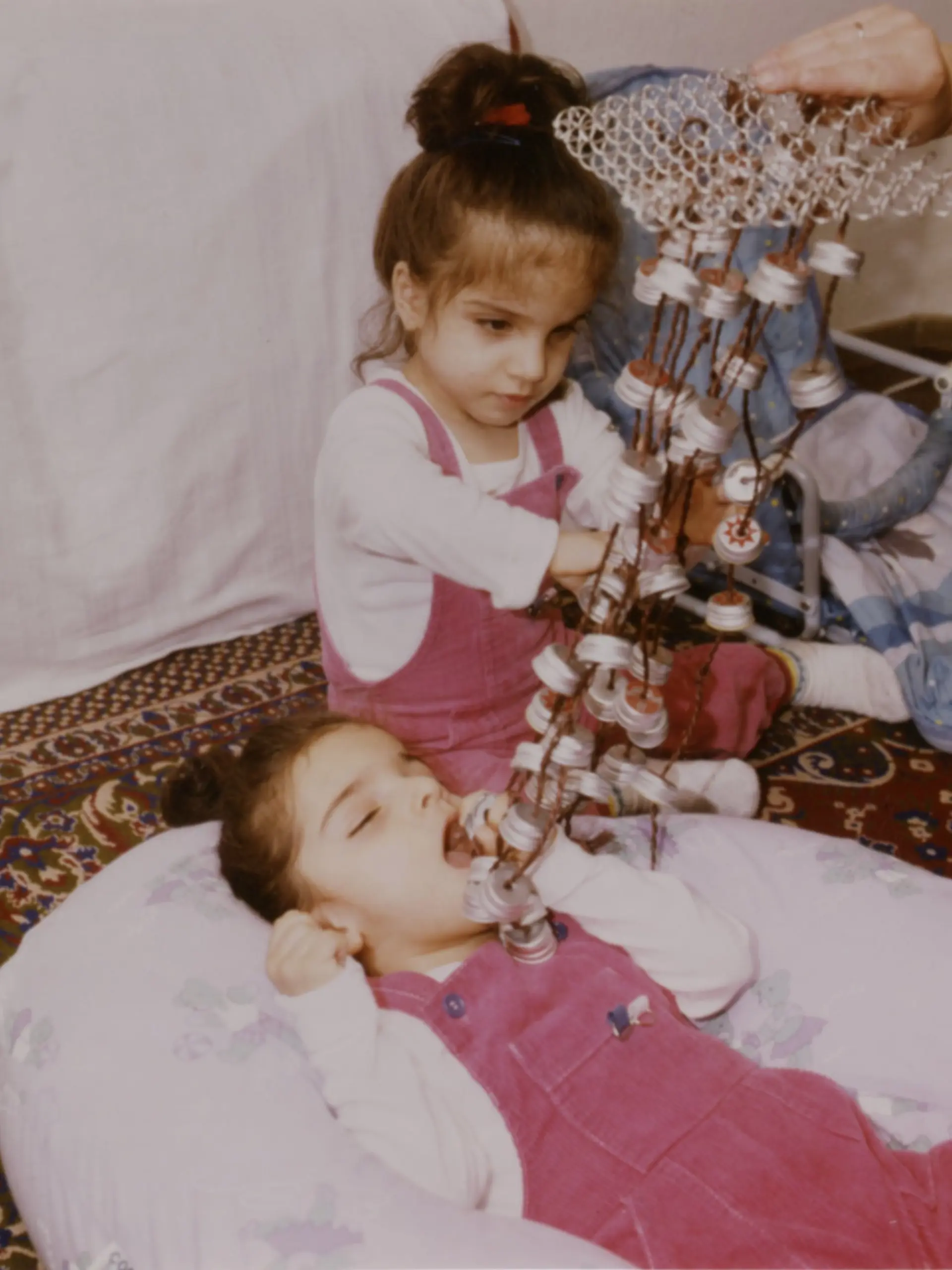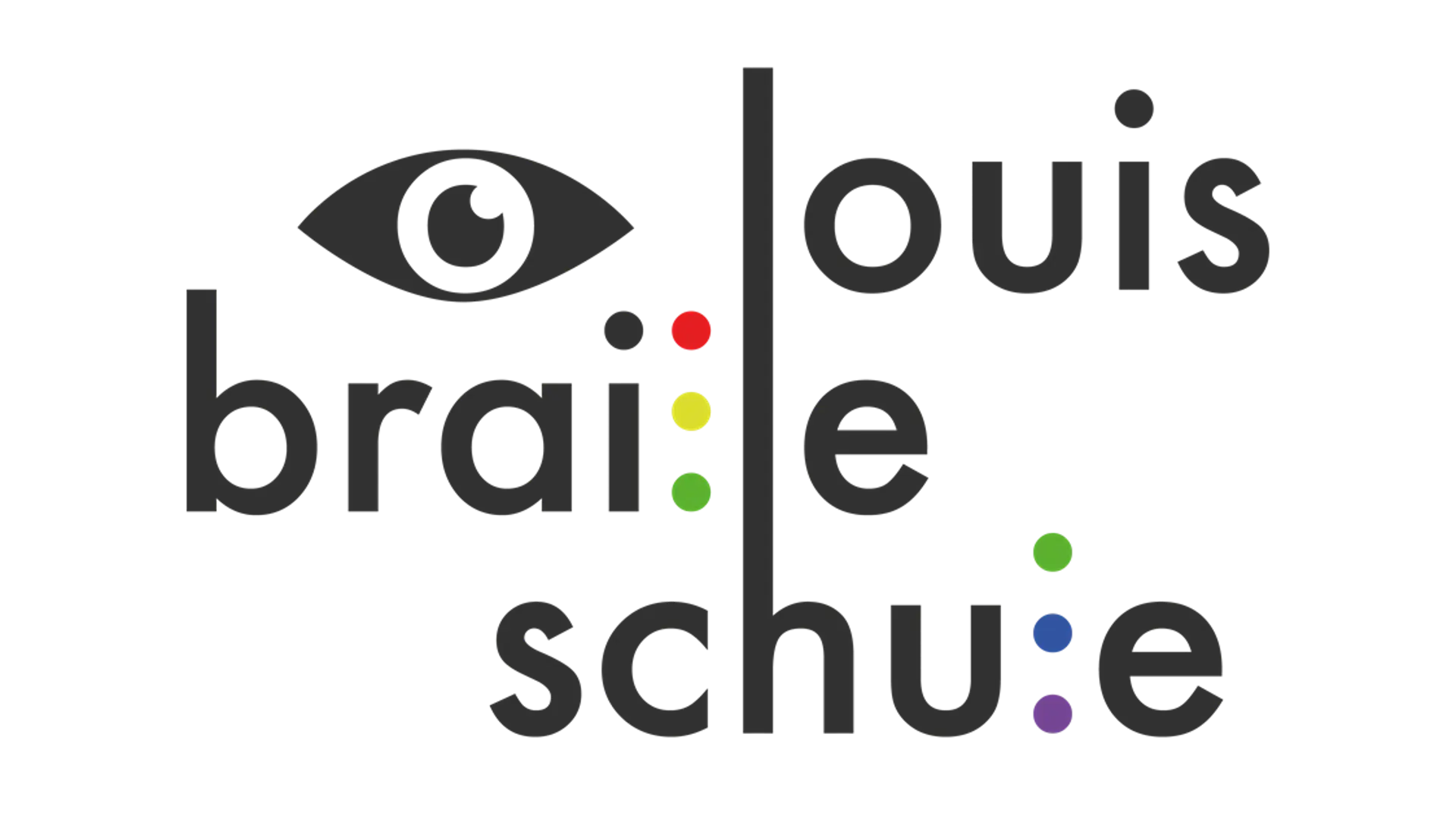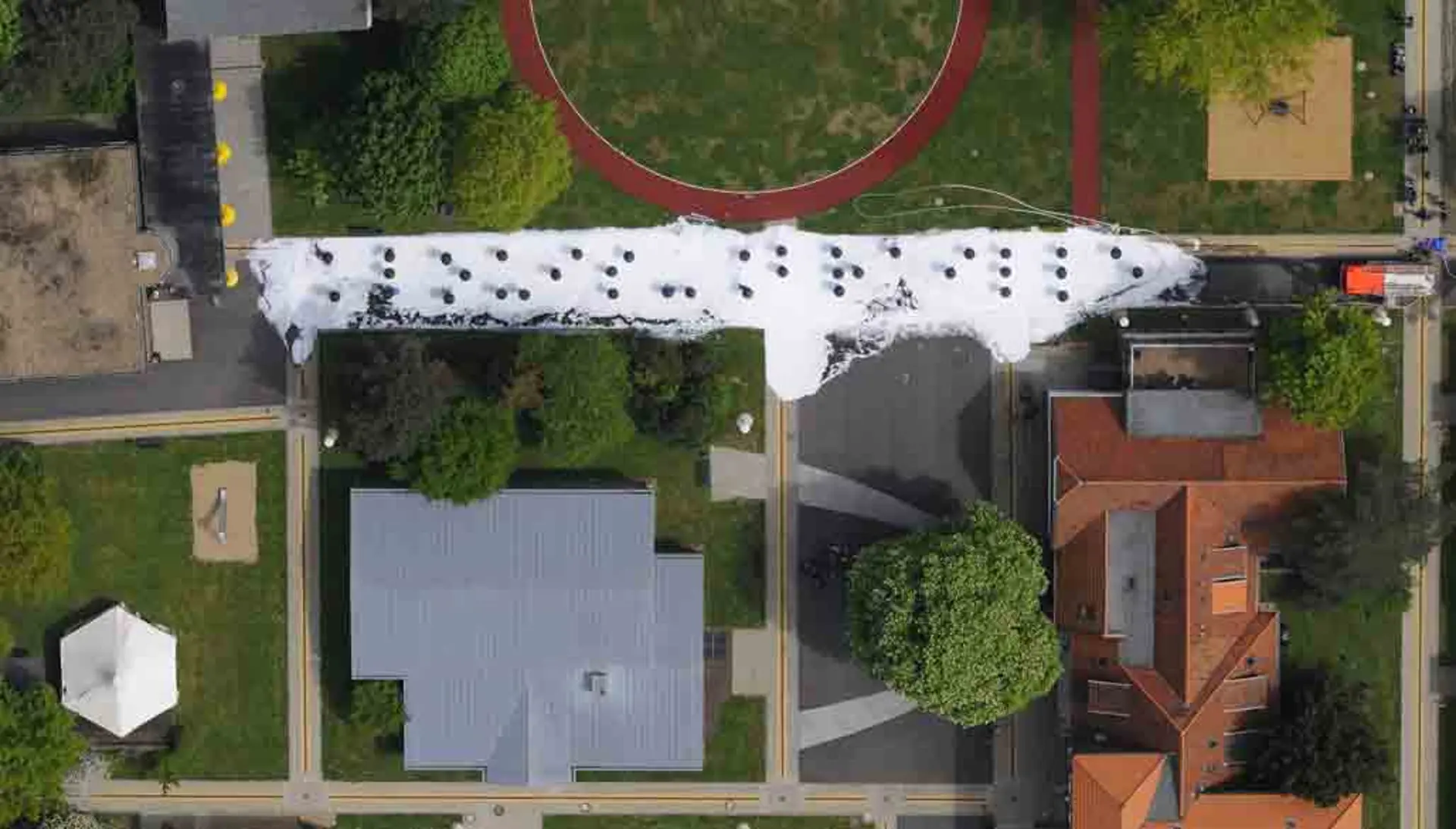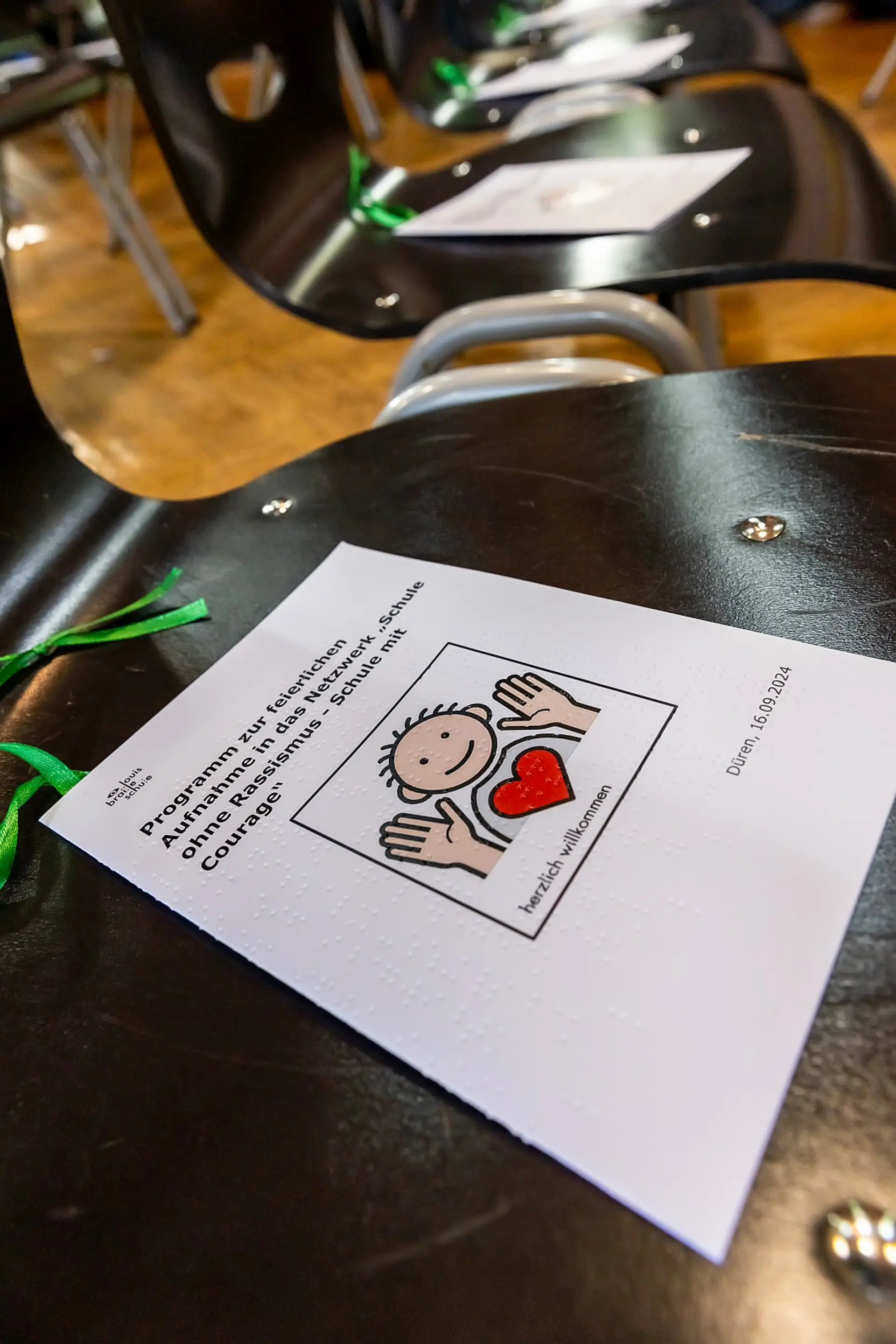(1) Schulgebäude: © LVR-Louis-Braille-Schule
(2) Statuten Elisabeth-Stiftung: Mit freundlicher Genehmigung des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)
(3) Grundriss Jesuitenkloster: Mit freundlicher Genehmigung des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)
(4) Fotografie des ehemaligen Jesuitenklosters: Aus "150 Jahre Blindenbildung in Düren" (Fotograf unbekannt)
(5) Gelände der Provinzial-Blindenanstalt: Mit freundlicher Genehmigung des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)
(6) Schülerin liest Punktschrift: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)
(7) Fotografie Vorschulunterricht in den 20er Jahren: Foto aus "Die Rheinische Provinzial-Verwaltung. Ihre Entwicklung und ihr heutiger Stand" 1925, S. 237
(8) Gelände der Provinzial-Blindenanstalt mit Turnhalle, Knabenhaus und Wirtschaftsgebäude: Foto aus "Die Rheinische Provinzial-Verwaltung. Ihre Entwicklung und ihr heutiger Stand" 1925, S. 231
(9) Hauptgebäude der Provinzial-Blindenanstalt: Foto aus "Preisverzeichnisse für von Blinden hergestellte Erzeugnisse"
(10) Geländeplan der Provinzial-Blindenanstalt: Foto aus "Die Rheinische Provinzial-Verwaltung. Ihre Entwicklung und ihr heutiger Stand" 1925, S. 233
(11) Aula der Provinzial-Blindenanstalt: Foto aus "Der LVR" 1958, S. 193
(12) Schwimmbad der Provinzial-Blindenanstalt: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)
(13) Fotografie von Theodor Düren bei Frühförderung eines Kindes: Foto Pressestelle des LVR © (Kierblewsky/Ströter)
(14) Schüler*innen im Sandkasten vor den Internatsgebäuden: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)
(15) Schülerinnen vor den Internatsgebäuden: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)
(16) Schüler*innen beim Sport in der Gymnastikhalle: Foto Pressestelle des LVR © (Kierblewsky/Ströter)
(17) Schüler*innen springen beim Sport in der Turnhalle von der Sprossenwand in die Tiefe: Fotokartei der LVR-Pressestelle, © Fotograf Gregor Kierblewsky (LVR)
(18) Schüler*innen mit Komplexer Behinderung beim Spielen: "Blindenschule im Bild", mit freundlicher Genehmigung des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)
(19) Kind beim Schulreiten: © LVR-Louis-Braille-Schule
(20) Behindertengerechtes Schwimmbad: © LVR-Louis-Braille-Schule
(21) Küche im Hauswirtschaftsraum: © LVR-Louis-Braille-Schule
(22) Kind bei Einzelförderung: © LVR-Louis-Braille-Schule
(23) Blick auf Schulgebäude mit Blindenleitsystem: © LVR-Louis-Braille-Schule
(24) Schullogo: © LVR-Louis-Braille-Schule
(25–28) Bilder Schaumparty mit Feuerwehr: © LVR-Louis-Braille-Schule
(29) "Louis-Braille goes wild": © LVR-Louis-Braille-Schule
(30) Logo "Nationalpark Schule": © Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen
(31) "Louis-Braille goes wild": © LVR-Louis-Braille-Schule
(32) Orthoptistin untersucht Kind: © LVR-Louis-Braille-Schule
(33) Schülerinnen und Schulleitung mit Festschrift: © LVR-Louis-Braille-Schule
(34) Gruppenbild zum Festakt: © LVR-Louis-Braille-Schule
(35–42) Bilder zur feierlichen Übergabe der Urkunden: © LVR-Louis-Braille-Schule